Friktionen
Eine Ethnografie globaler Verflechtungen
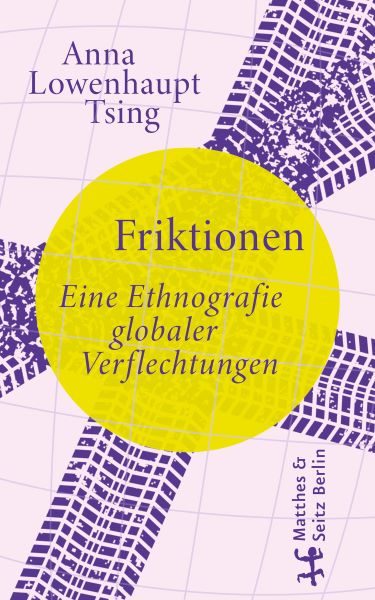
- Buch
- Tsing, Anna Lowenhaupt
- Matthes & Seitz, 2025. - 479 Seiten
„Globale Verflechtungen sind allgegenwärtig. Wie also erforscht man das Globale?“ Diese Frage stellt mit Ethnografien befasste Disziplinen vor eine Herausforderung, war diese Methode doch ursprünglich auf die Erforschung kleiner Gemeinschaften ausgelegt. Den Versuch einer Ethnografie globaler Verflechtungen unternimmt Anna Lowenhaupt Tsing mit ihrer Monografie „Friktionen“ (erstmalig 2005 veröffentlicht) in einer Kombination von Feldforschung und teilnehmender Beobachtung, Reportage und eigenständiger Theoriebildung. Dabei entwirft die chinesisch-amerikanische Ethnologin eine Forschungsstrategie mit kritischem Impetus: Die Analyse globaler Verflechtungen betreibt sie nicht anhand abstrakter Vorstellungen von Macht und Wissen, sondern möchte jene anhand konkreter „Friktionen“ greifbar machen: „Globale Verflechtungen verleihen dem Streben nach Universalität eine Art Griffigkeit. (…) Wenn wir nicht mehr am Universalen als einer sich selbst erfüllenden abstrakten Wahrheit festhalten können, müssen wir uns in konkrete Situationen hineinbegeben. So besehen ist es immer, und immer wieder von Neuem, notwendig, dass wir uns mitten ins Getümmel stürzen.“ Mitten ins Getümmel stürzt sich Anna Lowenhaupt Tsing im Falle von „Friktionen“ in die Wälder des bornesischen Meratusgebirges bzw. in den Kontakt mit der dort wohnenden indigenen Bevölkerung, der sie im Laufe ihrer Forschung freundschaftlich und familiär verbunden wird. Die Regenwälder erscheinen dabei nicht als bloßer Naturraum, sondern als soziale Landschaft, durchdrungen von kolonialen Spuren, indigenem Wissen, extraktivistischen Interessen und Umweltaktivismus. In dichten ethnografischen Beschreibungen analysiert sie, wie Forstpolitik, internationale Umweltabkommen, indigene Bewegungen und globale Märkte aufeinanderstoßen – und sich gerade in diesen Reibungen Globalität materialisiert. Dabei vollzieht ihre Theoriebildung etwa Anschlüsse an Walter Benjamins geschichtsphilosophische Thesen und den Neuen Materialismus, aber auch an postkoloniale und feministische Theorien. Anschaulich erzählt und mit bereichernden methodischen Überlegungen ist Friktionen sowohl innovative Ethnografie als auch politische Ökologie, vor allem aber gegenhegemoniale Analyse des globalen Kapitalismus. Dieser erscheint in „Friktionen“ nicht als fortschreitender teleologischer Siegeszug, sondern wird mit all seinen Brüchen, Widersprüchen und Widerständen stetig „friktional“ erzeugt wird: „Die Globalisierung wird nicht im Ganzen und rund geliefert wie eine Pizza, die von den hungrigen Rändern her aufgegessen und zerlegt werden kann. Globale Verflechtungen werden in Fragmenten hergestellt – auch wenn einige Fragmente Mächtiger sind als andere.“