Atlas der Unordnung
60 Karten über sichtbare, unsichtbare und sonderbare Grenzen
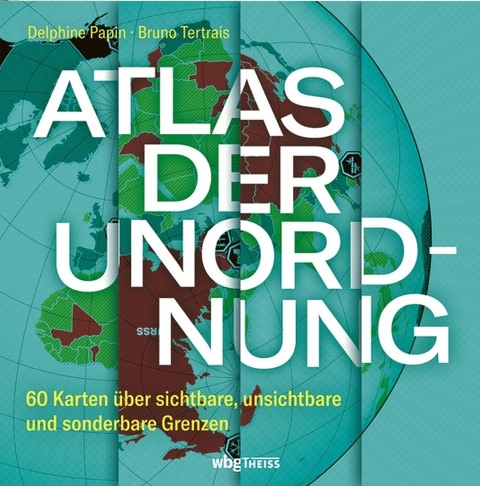
- Buch
- Papin, Delphine et al.
- wbg Theiss, 2022. - 175 Seiten
Seit etwa einem Jahrzehnt erführen Grenzen wieder geopolitische Hochkonjunktur, leiten Delphine Papin und Bruno Tertrais ihren Band mit Verweis auf große Migrationsbewegungen, die Covid-19-Pandemie oder Grenzkonflikte ein. Die Geografin und der Politikwissenschaftler widmen ihren „Atlas der Unordnung“ insofern vor allem den Grenzen dieser Welt, die in der nationalstaatlichen Moderne nicht nur Territorien und Menschen ordnen, sondern auch durchlässige Schnittstellen oder Membranen sein können. In einem vorangestellten Kapitel führen sie in die Thematik ein und diskutieren etwa die unterschiedliche Genese von Grenzen durch Kriegsführung, Abspaltung, Kolonialismus oder Vertragsumsetzung oder Funktionen und Logiken staatlicher Grenzen. Deutlich machen sie, dass Grenzen nie unumstritten sind und in den seltensten Fällen eindeutig zwischen Nationen, Ethnien oder Sprachgruppen verlaufen. In diesem Zusammenhang dekonstruieren die beiden Verfasser_innen auch die vermeintliche „Natürlichkeit“ mancher Grenzen im Kontrast zu solchen „künstlichen“ Ursprungs und verweisen auf den entscheidenden menschlichen Beitrag: Erst der Mensch mache einen Fluss o.Ä. zu einer Grenze und lade das vorderhand unschuldige Relief mit politischer, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung auf. In der Folge veranschaulicht der Band mit 60 kartografischen Visualisierungen unterschiedliche Grenzen, damit verbundene Konsequenzen, Konflikte und Entwicklungen. Im ersten Abschnitt „Grenzen als Vermächtnisse“ werden dabei Grenzen als „Geografie gewordene Geschichte“ gefasst, behandelt werden konkret etwa Grenzkonflikte in Südamerika, Kolonialgrenzen in Südasien oder Trennlinien des Kalten Krieges. Der zweite Abschnitt befasst sich mit Meeren und Grenzen, also staatlicher Hoheitsgewalt in Meeren, geopolitischen Konflikten um Meeresgebiete wie das Südchinesische Meer oder den Golf von Guinea. In „Mauern und Migration“ wiederum werden Grenzbefestigungen, Migrationsregime und Barrieren untersucht, verhandelt werden implizit auch die Privilegien des Globalen Nordens. Der vierte Abschnitt sammelt spezielle Grenzen, Kuriose und Sonderfälle, etwa die Enklaven-Region Cooch Behar in Südasien, die Datumsgrenze oder Guantánamo. Der fünfte und letzte Teil „Umstrittene Grenzen“ adressiert schlussendlich explizit jenes Konfliktpotenzial von Grenzen, das auch in den vorangegangenen Abschnitten bereits präsent war. Fallbeispiele sind hier etwa die Golanhöhen, die „Narben der Fragmentierung“ Ex-Jugoslawiens, das Horn von Afrika oder – von der Zeitgeschichte mittlerweile überholt – der „Ukraine-Konflikt“. Mittelfristig prognostizieren die Verfasser_innen Grenzen „eine glänzende Zukunft“, da trotz supranationaler Institutionen, der globalisierten Wirtschaft und nichtstaatlicher Akteur_innen der Nationalstaat nach wie vor das entscheidende Element des globalen Systems bleibe.